
Es war ein kalter Donnerstagmorgen, und vom Nass der Wasserwerfer war der Boden auf dem Maidan matschig getreten. An vielen Stellen fehlten Pflastersteine, die die Aufständischen als Geschosse für ihre Katapulte benutzt hatten. Auf den Barrikaden brannten Autoreifen. Direkt dahinter warfen Demonstranten Molotowcocktails. Und immer wieder fielen Schüsse. Männer, die Gasmasken oder Motorradhelme über ihre Köpfe gestülpt hatten, trugen Verletzte durch das Stadtzentrum Kiews, dieser eigentlich wunderschönen europäischen Hauptstadt der Ukraine. Viele von ihnen brüllten vor Wut, andere flehten im Schmerz. Es roch nach Verbranntem an diesem 20. Februar 2014. Und überall knallte es.
Als er vor mir auf der Institutska-Straße am Rande des Maidans lag, war er 51 Jahre und 117 Tage alt. Sein gelbes Halstuch war über sein Gesicht gerutscht. Er bewegte sich nicht mehr. Und um ihn herum standen Männer, die ihn und sich anschrien.
Zwei von ihnen, die neben ihm niedergekniet waren, versuchten sein Herz wieder zum Schlagen zu bringen. Einer presste heftig mit übereinandergelegten Händen auf seine Brust. Der andere drückte mit Daumen und Zeigefinger seine Nasenlöcher zu, legte den Mund auf seinen und hauchte Luft hinein. Fünf-, sechsmal wiederholten sie den Versuch des Wiederbelebens. Vergebens.
Wie die beiden Sanitäter ihn bearbeiteten, wie er dort auf dem Boden lag, wie sich um ihn herum das Chaos weiter ausbreitete: Wer nie im Krieg war, kann schlecht beurteilen, ob diese Szene kriegsähnlich war. Nach etwa 20 Minuten hoben die beiden seinen Körper auf eine Spanplatte. Den Kopf bedeckten sie mit einem dreckigen Pullover. So trugen sie ihn weg, in eine provisorisch eingerichtete Leichenhalle in der Michaelskathedrale, etwa 700 Meter vom Maidan entfernt.
Das St. Michaelskloster ist nicht irgendeine Kirche: Riesenkuppel, vergoldete Dächer, hellblau strahlende Wände. Man muss sich diese Kathedrale vorstellen, etwa im Sommer 2012, als das Finale der Fußballeuropameisterschaft in Kiew ausgespielt wurde, als Touristen davor standen, Fotos knipsten, lachten, um danach mit Freunden oder der Familie in eines der unzähligen Restaurants am Maidan einzukehren. Am Nachmittag des 20. Februar 2014 lag hier eine Leiche neben der anderen. Auf das linke Bein eines Leichnams hatte jemand mit einem grünem Filzstift Namen und Geburtsdatum geschrieben: Andrij Saienko, 26.10.1962.
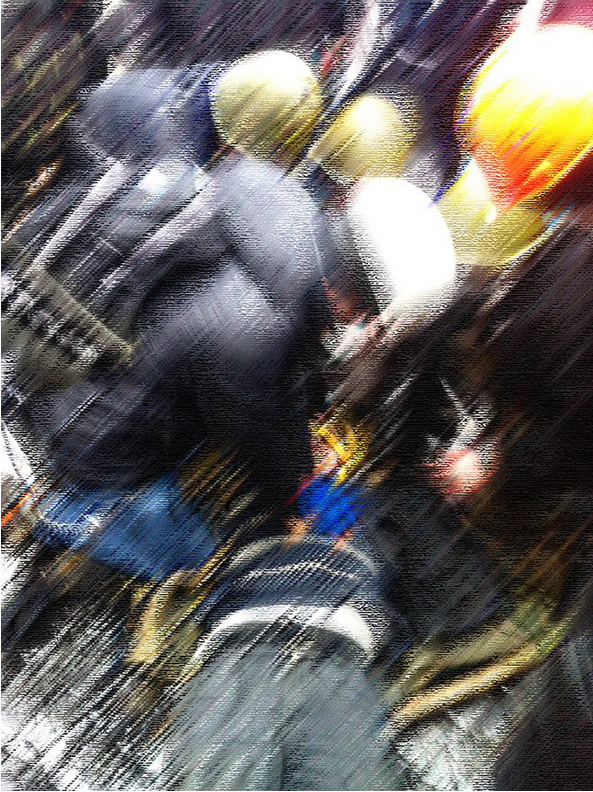
Wer ist das? Und was hat ihn auf den Maidan geführt? Vor der Leichenhalle am Michaelplatz beginnt vor fünf Jahren meine Suche nach dem, was das Leben von Andrij Stepanowitsch Saienko ausgemacht hat.
1. Die Mutter
Am Abend des 19. Februar 2014 säuberte Valentina Pavlivna Saienko einen Fisch. Sie nahm die Gräten aus dem Fischleib, wendete das Fleisch in Mehl und legte es danach zusammen mit einigen Zwiebelstückchen in die Bratpfanne. Als der Fisch angebraten war, legte sie ihn in einen Topf mit Tomatensauce und ließ das Lieblingsgericht ihres Sohnes eine Weile garen. Im Radio hörte sie dabei, was auf dem Maidan in Kiew geschah. “Ich habe ja keinen Fernseher”, sagt sie, während sie sich erinnert. Im Radio hätten sie erzählt, dass wieder Wasserwerfer eingesetzt worden waren. “Wenn er doch was gesagt hätte! Es war doch so kalt. Ich hätte Andrij warme Sachen und trockene Stiefel bis nach Kiew gebracht.”
Als das Essen für den nächsten Tag vorbereitet war und das Feuer im Ofen in ihrer kleinen Wohnung in ihrem Dorf loderte, legte sich die vierfache Großmutter ins Bett. Am nächsten Tag, dem 20. Februar 2014, wachte sie um 6 Uhr auf, packte den zubereiteten Fisch in ihre Tasche und machte sich auf den Weg zum Bahnsteig. Sie nahm den Zug um 7:20 Uhr Richtung Fastiw. Gegen 8 Uhr kam sie in der Wohnung ihres Sohnes an.
Ihre beiden erwachsenen Enkel waren zu Hause, aber Andrij nicht. Als sie das letzte Mal mit ihm telefoniert hatte, hatte er gesagt, dass alles in Ordnung sei und dass er am 20. Februar vom Maidan nach Hause kommen wolle. Dort wollten sie sich treffen. Er kam aber nicht. Valentina Saienko versuchte ihn auf seinem Handy anzurufen, dreimal.
Gegen zehn Uhr stellte sie den Fisch in die Küche und machte sich auf den Rückweg. Als sie gerade wieder am Bahnhof angekommen war, um den 11-Uhr-Zug zurück in ihr Dorf zu nehmen, klingelte ihr Telefon: Andrijs Bruder Juri, ihr älterer Sohn. Er sagte, dass auch er Andrij nicht erreichen konnte. Aber als er es eben noch mal versucht hatte, habe ein anderer Mann abgenommen. Er habe gesagt, dass Andrij tot sei.
Valentina Saienko spricht leise, während sie von den letzten Tagen im Leben ihres Sohnes erzählt. Wir haben uns in einem Café in einer ehemaligen Kirche in Fastiw getroffen, ihr ältester Enkel ist auch gekommen. Sie hat mir, dem ihr unbekannten Reporter, Süßigkeiten mitgebracht und Walnüsse aus ihrem Garten. Ihr Kopftuch nimmt sie während der knapp vier Stunden, die wir reden, nicht ab. Sie erzählt davon, wie ihr Sohn ihr früher bei Reparaturen in ihrem Haus geholfen hat, wie sportlich Andrij gewesen sei. Dabei zeigt sie alte Familienfotos: Schwarz-Weiß-Aufnahmen, auf denen er als Kind spielt; Bilder, auf denen er im Anzug mit der ganzen Familie beim Fotografen war. Kurz hat sie Tränen in den Augen.
Um ihn zu besuchen, kam Valentina Saienko regelmäßig mit dem Zug aus ihrem nahegelegenen Dorf nach Fastiw. Die Fahrt dauert keine halbe Stunde. Sie brachte oft Obst, Gemüse oder vorgekochtes Essen mit. Sie liebte ihren Sohn, sagt sie. Er habe immer warme Hände gehabt. Und zum Fisch habe er gerne Kartoffelpüree gegessen.

Schon im Jahr 2004, nach der Orangen Revolution, bei der die Ukrainer wegen Wahlfälschungen für eine Wiederholung der Präsidentschaftswahlen friedlich demonstrierten, habe er sich als 42-Jähriger freiwillig als Wahlbeobachter gemeldet. Auch im Herbst 2010, als Tausende Selbstständige beim sogenannten Tax-Maidan in Kiew gegen die neuen Steuergesetze von Präsident Viktor Janukowitsch protestierten, sei Andrij dabei gewesen.
Ihr Sohn traute den ukrainischen Politikern nicht, sagt sie. Und am 20. Februar 2014 sei er nicht zufällig gestorben. Er sei von Scharfschützen, die auf Befehl des damaligen ukrainischen Präsidenten gehandelt hätten, erschossen worden. “Janukowitschs Leute waren das”, sagt sie. Ihr Sohn habe keine solchen Waffen gehabt. Er und die anderen Demonstranten hätten auf dem Maidan mit “Steinen und Holzlatten” gekämpft. “Sind das etwa richtige Waffen?”
Ihre Frage ist eine von jenen, die keine Antwort erwarten.
2. Zu Hause
Fastiw ist eine normale ukrainische Stadt. Alte Sowjetbauten, Beton, eine prunkvolle Kirche sowie einzelne Häuser mit Blechdächern und der gestaute Unawa-Fluss bestimmen das Ortsbild. Viele der etwa 40.000 Einwohner fahren von hier täglich zum Arbeiten in die Hauptstadt nach Kiew, das nur etwa eine gute Stunde nordöstlich liegt.
Wer auf dem Friedhof in Fastiw steht, hört die Züge aus Kiew vorbeirattern. Zwei Tage nach seinem Tod wurde Andrij Saienko hier begraben. Zur Bestattung kamen so viele Bürger, dass auf allen Friedhofswegen kein Platz mehr war. Ein paar Wochen nach der Beisetzung wurde er zum Ehrenbürger seiner Heimatstadt ernannt. Eine kurze Straße im Stadtzentrum bekam seinen Namen. Вул. Андрія Caєnka // Vul. Andrya Sayenka steht in kyrillischer und in lateinischer Schrift an einer Hauswand aus roten Ziegeln, darunter hängt eine dunkle Platte mit seinem hellen Gesicht. Auch an der Schule Nummer 2, die er als Schüler besuchte, hängt neben der Eingangstür eine Gedenktafel. Die Einwohner Fastiws laufen im Alltag an ihr vorbei, ohne sie zu bemerken.

Nach dem Studium arbeitete Andrij Saienko in einer Fabrik in Fastiw. Er reparierte Transformatoren für Züge. Danach, im Jahr 2000, machte er sich selbstständig, fuhr gelegentlich zum Arbeiten nach Polen. Im Markt von Fastiw führte er ein kleines Geschäft. Aus dem grauen Container mit der Nummer 101 verkaufte er Tee, Kaffee, Ketchup, Mayonnaise, Kaffeesahne und Lebensmittel in Dosen.
Ukraine: Andrij Saienkos Sohn Olexij (rechts) und seine Mutter Valentina (Mitte) stehen in Fastiw in der kurzen Straße, die nach ihm benannt wurde.
Für “seinen Mut, seinen Patriotismus, seinen Kampf für Freiheit und Menschenrechte” bekam er im Herbst 2014 wie viele andere, die auf dem Maidan starben, vom neuen Präsidenten Petro Poroschenko den Titel des “Helden der Ukraine” verliehen. Ein Jahr später folgte die Tapferkeitsmedaille, unter anderem für “seine Liebe zur Ukraine”. Im amtlichen Obduktionsbericht heißt es unter Punkt 10.a. über die Ursache seines Todes: “Schusswunden in der Brust”.
Seine Familie weiß bis heute nicht, wer die Schüsse auf ihn abfeuerte. Offiziell dauern die Ermittlungen noch an. Der mittlerweile fünfte Generalstaatsanwalt, der seit der Revolution im Amt ist, sagte zuletzt, man sei nun immerhin so weit, die Anklagen gegen jene zu formulieren, die die Schießbefehle gegeben hätten. Sie seien allerdings nach Moskau geflohen.
3. Die Revolution
Es gibt Tage, die teilen vieles in ein Davor und ein Danach. Der 9. November 1989 ist für die deutsche Gesellschaft so einer: der Tag, an dem die Mauer fiel und die friedliche Revolution der DDR besiegelte. Womöglich braucht der Lauf der Dinge solche Tage immer dann, wenn er einen neuen Weg einschlagen will. An ihnen endet Vergangenes und orientiert sich Zukünftiges. Für die Ukraine gilt das für den 20. Februar 2014. Er war der blutigste und wohl chaotischste Tag, den das Land bis dahin seit Ende des Zweiten Weltkrieges neben der Katastrophe von Tschernobyl erlebt hat. Fast die Hälfte der 127 Menschen, die während des Volksaufstandes in Kiew ums Leben kamen, starb an diesem einen Tag, dem Höhepunkt der Euromaidan-Revolution.
Die Revolution der Würde, wie der Volksaufstand nachträglich auch genannt wird, hatte im November 2013 begonnen. Einige junge Ukrainer, vor allem Studenten, hatten sich im Zentrum der Stadt aus Protest gegen die Regierung getroffen. Sie wollten weniger Korruption, mehr Rechtsstaat und dass Viktor Janukowitsch wie versprochen das fertig verhandelte Assoziierungsabkommen zwischen der Ukraine und der EU endlich unterschreibt.
Nachdem die Polizei fast alle Studenten vom Maidan geprügelt hatte, kamen am nächsten Tag etwa vier Mal so viele Demonstranten zurück und besetzten den Unabhängigkeitsplatz erneut. Der Protest wandelte sich in eine Massenbewegung, unterstützt von Rockbands, die auf dem Maidan spielten, Schriftstellern und anderen Künstlern. In der Nacht des 10. Dezember 2013 entsprang aus dieser sonderbaren Mischung der Funke einer Revolution.
Die Außenbeauftragte der EU hatte gerade die Stadt verlassen. Rund um den Maidan und auf der Institutska-Straße hatten sich Berkut-Einheiten positioniert. Die Spezialeinsatzkräfte wollten mit vielen Hundertschaften bis zum Zentrum des Maidans, auf dem die große Bühne stand, vorrücken. Per Lautsprecher forderten sie alle auf, den Unabhängigkeitsplatz zu verlassen. In dieser Nacht wird der Aufstand beendet, dachte ich, während die Polizeieinheiten sich in Bewegung setzten. Doch Hunderte Männer, Frauen, Studenten, Rentner, Großmütter, Beamte, Angestellte stellten sich den Polizisten entgegen. Andrij Saienko war einer von ihnen.
Die gepanzerten Polizisten drückten von der einen und die Revolutionäre mit ihren selbst gebauten Schilden, ihren Schienbeinschonern und Bauarbeiterhelmen von der anderen Seite der Barrikaden. Stundenlang zog sich dieser Machtkampf hin. Viele ältere Frauen streckten das Kreuz, das sie eigentlich um den Hals trugen, in die Luft. Sie beteten, dass die bis dahin friedliche Revolution nicht in Gewalt umschlägt.
Während die Berkut-Einheiten Meter um Meter aufs Zentrum des Unabhängigkeitsplatzes vorrückten, läuteten die Glocken in der Michaelskathedrale ohne Pause. Auf und neben der Bühne des Maidans sangen die Revolutionäre. Immer mehr Ukrainer kamen im Laufe der Nacht von überall ins Zentrum der Stadt gelaufen.

Als die Sonne aufging, zogen sich die Polizeieinheiten zurück. Die Gegenwehr der Bürger war zu stark. Viele Demonstranten weinten vor Freude und Erschöpfung, einige tanzten. In dieser Nacht hatten die Polizisten Tränengas eingesetzt. Vereinzelt hatten Demonstranten und Beamte zugeschlagen, aber Schusswaffen hatte noch niemand benutzt. Am Morgen danach begannen die Revolutionäre die Barrikaden, die den Maidan umschlossen, zu Festungsmauern aus Brettern, Einkaufswagen, Eisblöcken, Bettgestellen und Autowracks umzubauen. Fast zweieinhalb Monate hielt dieses improvisierte Bollwerk, bis zur Woche des 20. Februar 2014. Danach, nachdem die Polizisten an einem Tag mehr als 50 Bürger auf offener Straße niedergeschossen hatten, war die Ukraine ein anderes Land.
Mit der Eskalation auf dem Maidan am 20. Februar 2014 begannen russische Spezialeinheiten die Annexion der Krim umzusetzen und den Krieg im Südosten des Landes vorzubereiten. Auf der Halbinsel starb während der perfekt geplanten Übernahme des ukrainischen Landesteiles niemand. In Kiew wanderten dagegen am 21. Februar 2014 offene Särge mit getöteten Männern durch die Hände der Demonstranten. Die Bilder der Toten vom Vortag hatte noch niemand richtig verarbeitet. Aber die Revolution war jetzt nicht mehr aufzuhalten. “Wir werden Viktor Janukowitsch nicht mehr tolerieren”, schrie ein 26-jähriger Maidan-Kämpfer, der auf die Bühne des Maidan gesprungen war und sich unabgesprochen das Mikrofon genommen hatte. Die Worte des bis dahin unbekannten Wolodymyr Parasjuk waren kaum ausgesprochen, via Internet und Fernsehsignal in Millionen Haushalte übertragen, da reagierte die Menschenmenge mit einem gewaltigen Jubelausbruch.
Viktor Janukowitsch floh noch am Abend mit einem Hubschrauber aus Kiew, erst in den Osten der Ukraine und von dort nach Russland. Der ehemalige Präsident hat sich seitdem nie mehr zurück in die Ukraine gewagt. Erst vor wenigen Wochen, im Januar 2019, verurteilte ein Gericht in Kiew ihn in Abwesenheit zu 13 Jahren Haft wegen Hochverrats und der Mithilfe am Krieg gegen die Ukraine. Der Richter sagte, Janukowitsch habe Verbrechen gegen die “nationale Sicherheit” seines Landes begangen.
4. Der Sohn
Olexij Saienko kann sich nicht erinnern, ob er am 20. Februar 2014 etwas gefrühstückt hat oder nicht. Zu viel passierte an diesem einen Tag. Er weiß noch, dass er am Vortag spät von der Arbeit kam und seine Großmutter ihn und seinen jüngeren Bruder Nazar am Morgen besucht hatte. Sie wollte seinen Vater sehen. Nachdem sie gegangen war, dauerte es eine Weile, bis sein Onkel Juri nach Hause kam. Juri schaute ihn nicht an, als er sein Zimmer betrat. Er solle sich beeilen, schnell ein paar Sachen zusammenpacken, sagte Juri. Die beiden müssten sofort nach Kiew zum Maidan fahren. Denn dort sei sein Vater ermordet worden.
Gleich nachdem sein Onkel das Zimmer wieder verlassen hatte, liefen Olexij Tränen über sein Gesicht. Er fühlte sich seltsam leer, während er ein paar Sachen aus dem Schrank nahm. Das sei merkwürdig gewesen, erinnert er sich. Er sei nämlich niemand, der weint. Selbst ein paar Tage später, auf der Beerdigung seines Vaters, konnte er nicht mit Tränen trauern.
Auf der Fahrt von Fastiw nach Kiew saß Olexij neben seinem Onkel Juri. Beide sagten nichts. Es sei eine Art Schockzustand gewesen, erinnert sich Olexij. Er und Juri hätten kein einziges Wort miteinander geredet, die ganze Fahrt nicht. In Kiew angekommen gingen sie zu Fuß vom Hauptbahnhof zum Maidan. Die U-Bahnen waren ausgefallen. Eine chaotische Hektik lag über der Stadt. Als sie auf dem Unabhängigkeitsplatz ankamen, versuchten sie, sich darin zurechtzufinden. Sie fragten, wo die Erschossenen hingebracht wurden.
Zu diesem Zeitpunkt habe er insgeheim immer noch gehofft, dass alles eine Verwechslung sei, dass der Tote jemand anderes sei, sagt Olexij. Aber als sie am Michaelplatz ankamen, sah er ihn. Die Leiche habe nicht so ausgesehen, wie Olexij seinen Vater in Erinnerung hatte. Vermutlich hatte er Pullover und Hose kurz vor den tödlichen Schüssen gewechselt, da beides von den Wasserwerfern nass geworden war. Aber er war es. Es war sein toter Vater, der da in den Sachen eines anderen vor ihm lag.
Nachdem er ihn identifiziert hatte, folgte er der Leiche in ein Kühlhaus, in das am 20. Februar 2014 viele Todesopfer gefahren wurden. Danach gab es nichts mehr in Kiew zu tun. “Wir wussten nicht, wo wir sind. Auf dem Smartphone hatten wir kein GPS-Signal. Also liefen wir einfach zu Fuß los”, erinnert sich Olexij. Irgendwann fanden er und sein Onkel Juri einen Bahnhof. Sie nahmen einen Bus zurück nach Fastiw. Auf der Fahrt sahen sie einige Freunde, die auch vom Maidan kamen. Olexij sagte ihnen, dass sein Vater heute gestorben sei. Sie schauten ihn an. Dann redete er mit ihnen über “irgendetwas anderes, um irgendwie die Zeit zu überstehen”.
Olexij Saienko ist 30 Jahre alt und arbeitet in einem Fitnesscenter. Er ist groß und seine gut trainierten Muskeln fallen auf. Aber wenn er über seinen Vater spricht, wirkt er schwach. Er zögert, bevor er antwortet.
Sein Vater habe ihm gezeigt, wie man aus Knete Figuren baut, kaputte Schuhe wieder zusammennäht und welche Haltung man zum Leben einnehmen müsse, sagt Olexij. “Wenn er etwas versprochen hatte, dann hat er es auch gehalten. Egal was es ihn gekostet hat, er hat sein Versprechen gehalten. So war mein Vater, einer der ehrlichsten Menschen, die ich kenne.”
Um bei der Revolution zu helfen, sei sein Vater seit Dezember 2013 regelmäßig auf dem Maidan gewesen, sagt Olexij. Manchmal sei er zwischenzeitlich für ein paar Tage zum Arbeiten nach Fastiw gekommen, aber dann musste er wieder zurück zum Maidan. In der siebten Freiwilligeneinheit habe er dort gekämpft.
Einmal habe er Olexij mitgenommen auf den Unabhängigkeitsplatz. Zusammen hätten sie eine Nacht dort verbracht. Aber am nächsten Tag wurde Olexij krank. Obwohl er es gut fand, dass sein Vater auf dem Unabhängigkeitsplatz für die Freiheit der Ukraine kämpfte, wollte er selbst dort nicht mehr hin. Wäre die Revolution allerdings am 20. Februar 2014 nach dem Tod seines Vaters nicht erfolgreich gewesen, hätte Olexij sich wohl den Maidan-Kämpfern angeschlossen, sagt er.
Zwei Gegenstände, die einst seinem Vater gehörten, liegen heute in Olexijs Zimmer in Fastiw: das Feuerzeug, das sein Vater mit zum Maidan genommen hatte. Und ein kleines Kreuz, das jemand seinem Vater nach der Ermordung in die Hand gedrückt hatte. Sein Vater hatte nie geraucht und er war auch kein Unterstützer der Kirche. Doch beide Dinge, Feuerzeug und Kreuz, erinnern Olexij auf besondere Weise an ihn.
Als er das letzte Mal mit ihm gesprochen hatte, fragte Olexij seinen Vater am Telefon, was er auf dem Maidan gerade mache. Er haue Pflastersteine aus dem Boden des Unabhängigkeitsplatzes und bringe sie den Leuten, die damit auf die Spezialeinheiten der Polizei werfen, hatte sein Vater ihm geantwortet. Das Telefonat dauerte nur etwa eine Minute. Ob sonst alles okay sei, hatte Olexij noch gefragt. Mehr oder weniger okay, lautete die Antwort seines Vaters. Aber er werde bald nach Hause kommen. Das waren seine letzten Worte zu seinem Sohn.
Kurz bevor er starb, versuchte Olexij ihn noch einmal anzurufen. Aber auf dem alten Nokia 1100, das sein Vater eigentlich immer in der Tasche hatte, war er nicht mehr zu erreichen.
5. Freiheit und Tod
Freiheit sei im Wesentlichen ein Synonym für Glück, schrieb Anna Bahrjana nach dem Revolutionswinter 2014. Die Schriftstellerin, die wie Andrij Saienko aus Fastiw stammt, erinnert damit an den französischen Philosophen Nicolas de Condorcet. Das Wort “revolutionär” passe nur zu Volksaufständen, deren Ziel die Freiheit ist, stellte der Erfinder der Volksinitiative im 18. Jahrhundert fest.
Auch der ukrainische Filmregisseur Oleg Senzow, der noch heute in Russland in Gefangenschaft sitzt, demonstrierte auf dem Maidan für diese Freiheit. Weil er sich freiwillig mit einem Hungerstreik gegen die Anerkennung der Krim-Besetzung wehrte, starb er fast. Er sagte, die ganzen zwei Monate Revolutionswinter auf dem Maidan würden in die 24 Stunden des 20. Februar 2014 passen, “sogar mein ganzes Leben passt da rein”.
Ohne die Eskalation auf dem Maidan säße Oleg Senzow heute nicht im Gefängnis, wäre Viktor Janukowitsch 2014 wohl nicht geflüchtet, hätte Russland vielleicht nicht den Krieg gegen die Ukraine begonnen, wären nicht bis heute 12.576 Menschen in diesem Krieg gestorben, wäre bestimmt auch Andrij Saienko noch am Leben.
Als Reporter stand ich damals neben ihm. Ich schaute in sein Gesicht, auf seinen Bauch, seine Beine, seine Schuhe und wusste nicht, was ich tun sollte. Sein Tod traf mich unvorbereitet. Er war nah und fremd. “#Euromaidan wieder komplett von Protestlern eingenommen, um welchen Preis? Vor mir liegt toter Mann“, tippte ich damals in mein Smartphone.
Jeder Mensch hat Standpunkte, Sichtweisen, eine Haltung. Meine Überzeugungen änderten sich auf dem Maidan. Als ich Andrij Saienko traf, endete sein Leben. Meines wandelte sich. Den Wert einer Demokratie, die Errungenschaften der Europäischen Union und das Glück des friedlichen Mauerfalls in Deutschland erkannte ich erst nach dieser zufälligen Begegnung mit ihm.
Seit der Revolution bin ich jedes Jahr wieder in die Ukraine gereist, habe über den russisch-ukrainischen Krieg recherchiert, begonnen, beide Sprachen zu lernen. Und seit dem Revolutionswinter steht in meinem Wohnzimmer ein gelber Helm. Ich trug ihn während der Tage auf dem Maidan. Er sollte mich damals vor Steinen und anderen Geschossen schützen. Mittlerweile ist er ein Symbol für den Willen der Ukrainer geworden: Für eine gerechtere und freiere Gesellschaft nach europäischem Vorbild haben sie auf dem Maidan nicht nachgegeben.
Um fünf Jahre danach das Erbe dieser Revolution zu verstehen, bin ich durch Andrij Saienkos Wohnung gegangen, habe sein Grab auf dem Friedhof in Fastiw besucht, mit seiner Familie, seinen Nachbarn und anderen, die zur gleichen Zeit am gleichen Ort in Kiew waren, gesprochen. Aber was können alle Rechercheergebnisse über den Grund oder gar den Sinn seines Todes aussagen?
Andrij Saienko war offenbar ein engagierter Mann, der lieber zupackte, als lange zu reden. Für die Zukunft seines Landes warf er Molotowcocktails. Aber weder seiner Mutter noch seinen Söhnen hat er viel von seinem Kampf auf dem Maidan erzählt. Von seiner Frau lebte er getrennt. Schwer zu sagen, ob er sich von der Dynamik des Maidans mitreißen ließ oder selbst die Demonstranten angetrieben hat. Unklar ist auch, wie politisch er dachte, wie er zu Viktor Janukowitsch stand und ob er die Gefahr gesucht hat.

Um für einen Staat zu kämpfen, der ihn wohl nie überzeugt hatte, hat er seine Söhne alleine Zuhause gelassen. Für einen gesellschaftlichen Wandel hat er alles riskiert. In Andrij Saienkos Geschichte geht es um mehr als Steineschmeißen auf einer Demo. Es geht um die Frage, ob ein Leben über den Tod hinausreichen kann. Was bleibt, wenn die Tapferkeitsmedaille vergeben und der letzte Seufzer auf der Beerdigungsfeier verstummt ist? In Fastiw ist er seitdem so bekannt wie niemals während seines Lebens. Aber vielleicht wird die Straße, die nach ihm benannt ist, bald in den Köpfen der Bürger keine Bedeutung mehr haben. Womöglich ist er gar kein Held. Menschen, sobald sie sterben, hängen in ihrem Wirken von den Erinnerungen der Hinterbliebenen ab. Ein Toter kann auf ewig hochleben oder einfach vergessen werden. Jeder hat die Freiheit, ihm seinen eigenen Sinn zu geben. Oder anders ausgedrückt: Andrij Saienko hat im Tod seine Freiheit verloren, weil sein Vermächtnis seitdem an den Gedanken der Nachwelt hängt.
Nach drei Stunden, die ich mit Andrij Saienkos Mutter und seinem älteren Sohn geredet habe, bestellen wir eine vierte Kanne Tee.
Herr Saienko, hat der Tod Ihres Vaters etwas bewirkt?
Olexij Saienko: Das ist eine sehr schwere Frage. Ich kann nicht klar antworten. Niemand wurde bisher dafür bestraft, was auf dem Maidan im Februar 2014 passiert ist. Und es gibt heute immer noch Korruption in unserem Land. Dagegen wollte mein Vater ja etwas tun.
Hat sein Tod eine besondere Bedeutung, Frau Saienko?
Valentina Saienko: Ich kann Ihnen das nicht beantworten. Aber der Schriftsteller Taras Schewtschenko hat ein Gedicht geschrieben: Traum. Darin heißt es: Jeder hat sein eigenes Schicksal. Daran glaube ich.
Olexij Saienko: Die Revolution, die er begonnen hat, ist noch nicht zu Ende. Ich hoffe, mein Vater ist nicht grundlos gestorben. Ich hoffe es wirklich. Es liegt an den Bürgern dieses Landes, ob er für etwas Gutes gestorben ist.
Valentina Saienko: Die Leute, die auf dem Maidan demonstriert haben, standen dort nicht umsonst. Wenn es sie nicht gegeben hätte, würde Wladimir Putin heute durch Kiew laufen und weiter behaupten, die Ukraine sei keine eigene Nation. Andrij war nicht alleine. Insgesamt haben drei Millionen Bürger demonstriert. Ich glaube, es war gut, dass sie dort zusammen waren. Es war gut, dass mein Sohn zum Maidan gegangen ist.
Dann ist er für etwas Gutes gestorben?
Valentina Saienko: Als sie angefangen haben, auf dem Maidan zu schießen, startete der Krieg. Viele Menschen sind im Kampf gegen den Teufel gestorben. Es war der Wille der Nation, für den sie ihr Leben gelassen haben. Ja, Andrij ist für die Freiheit unseres Landes gestorben.
Hinter der Geschichte: Kann man ein Porträt über einen Menschen schreiben, den man nur in den letzten Minuten seines Lebens erlebt hat? Und: Muss man die eigene Distanz zum Protagonisten einer Recherche aufgeben, wenn man ihn sterben sah? Beides fragte sich unser Autor fast fünf Jahre lang. Der 20. Februar 2014 und seine Folgen waren für ihn so einschneidend wie wenig zuvor und hinderten ihn lange, diesen Text zu schreiben.
Wichtig für die Recherche war ein Foto: Als unser Autor am Morgen des 20. Februar 2014 Andrij Saienko vor sich erblickte, machte er von der Szene am Rande des Maidan ein Handy-Foto. Er veröffentlichte es im Original nie, in abgewandelter Version sehen Sie es auf Seite zwei dieses Artikels. Im vergangenen Sommer kontaktierte er über Bekannte Wolodymyr Bondarchuk, dessen Vater ebenfalls am 20. Februar 2014 auf dem Maidan erschossen worden war. Bondarchuk hat für die NGO Familien der Himmlischen Hundert viele Stunden Videomaterial von der Gewalt auf dem Maidan ausgewertet. Nachdem unser Autor ihm sein Foto vom 20. Februar 2014 gezeigt hatte, erinnerte sich dieser sofort. Er schickte aus dem Archiv der NGO ein Video, auf dem zu sehen ist, wie zwei Sanitäter versuchen Andrij Saienko wiederzubeleben. So erfuhr unser Autor, wie der Tote vom Maidan heißt.